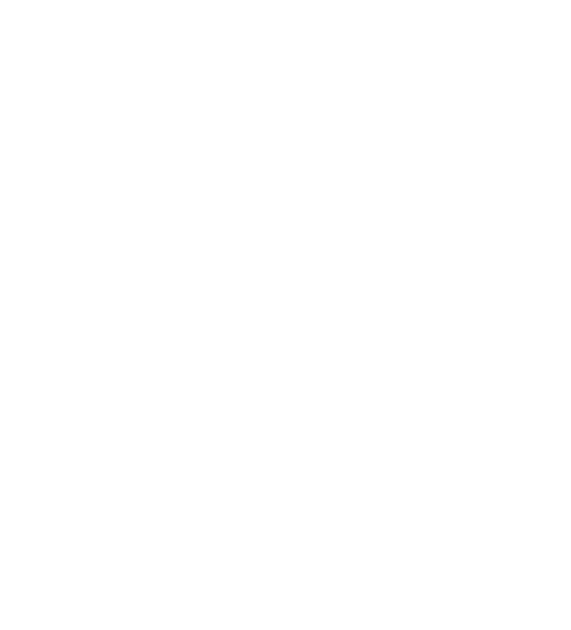Partikelanalysen von Medizinprodukten - Optischer Partikelzäher (OPZ) oder mikroskopische Auswertung?
Die Reinheit von Medizinprodukten ist entscheidend für die Patientensicherheit und die Wirksamkeit der Produkte. Verschiedene Normen und Richtlinien wie z.B. VDI 2083 Blatt 21, USP 788 und VDA 19.1 / ISO 16232:2018 geben Hinweise zur Bewertung der Partikelkontamination. Darin werden Methoden zur Partikelanalyse beschrieben, die sich in Anwendung, Zielsetzung und Aussagekraft deutlich unterscheiden, aber dennoch für den jeweiligen Zweck den optimalen Ansatz darstellen. Daher ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den Methoden zu verstehen und sie richtig einzusetzen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.
Welche relevanten Analysemethoden gibt es?
Optischer Partikelzähler (OPZ)
Der optische Partikelzähler basiert häufig auf dem Prinzip der Lichtblockade, bei dem, in einem Fluid geführten, Partikel die Lichtintensität reduzieren, wenn sie einen Lichtstrahl passieren. Die Änderung in der Lichtintensität kann daraufhin direkt in Größe des Partikels übersetzt werden. Diese Methode ermöglicht eine automatische Bestimmung der Partikelgröße und Anzahl.
Vorteile:
- Schnelligkeit: Automatisierte Messungen ermöglichen eine schnelle Analyse großer Probenmengen.
- Genauigkeit: Hohe Präzision bei der Bestimmung der Partikelanzahl.
- Wiederholbarkeit: Konsistente Ergebnisse durch automatisierte Prozesse.
Nachteile:
- Einschränkungen bei der Probenart: Nicht geeignet für Proben mit hoher Viskosität oder reduzierter Klarheit.
- Begrenzte Partikelidentifikation: Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen verschiedenen Partikeltypen.
- Begrenzte Partikelgrößenerfassung: Partikel werden üblicherweise nur bis zu einer Größe von 200 µm erfasst und deren Größe als Äquivalentdurchmesser bestimmt.
- Ungenaue Partikelgrößenmessung: Größe des detektierten Schattens hängt von der zufälligen Orientierung des Partikels relativ zur Lichtachse ab.
Manuelles Mikroskop
Die mikroskopische Auswertung kann durch die manuelle Zählung und Größenbestimmung von Partikeln unter einem Mikroskop erfolgen. Diese Methode wird oft als Ergänzung zur OPZ-Methode verwendet, insbesondere bei Proben, die nicht mittels OPZ analysiert werden können.
Vorteile:
- Flexibilität: Geeignet für eine Vielzahl von Probenarten, unabhängig von den Eigenschaften des Fluids (Viskosität, Trübung).
- Detailgenauigkeit: Ermöglicht die Identifizierung und Charakterisierung einzelner Partikel.
- Materialanalyse: Möglichkeit zur chemischen Analyse der Partikelzusammensetzung.
Nachteile:
- Zeitaufwendig: Manuelle Zählung und Analyse erfordern mehr Zeit und Aufwand.
- Subjektivität: Ergebnisse können je nach Erfahrung und Sorgfalt des Analytikers variieren.
- Kosten: Höhere Kosten durch den Einsatz spezialisierter Mikroskopsysteme und Software.
Automatisiertes Mikroskop
Automatisierte Mikroskopsysteme, wie sie für Sauberkeitsprüfung nach VDA 19.1 / ISO 16232:2018 verwendet werden, kombinieren ein Mikroskop mit motorisiertem Probentisch, einer Kamera und spezieller Software zur automatisierten Partikelmessung. Diese Systeme ermöglichen eine effiziente und genaue Analyse der Partikelgröße und Anzahl.
Vorteile:
- Effizienz: Schnelle und automatisierte Analyse großer Probenmengen.
- Genauigkeit: Hohe Präzision bei der Bestimmung der Partikelgröße und Anzahl.
- Dokumentation: Automatische Speicherung und Archivierung der Ergebnisse.
Nachteile:
- Kosten: Hohe Anschaffungskosten für das System und die Software.
- Komplexität: Erfordert spezialisierte Schulung und Wartung.
Wie werden die Partikelproben vorbereitet?
Optischer Partikelzähler (OPZ)
Die Probenvorbereitung für die OPZ-Analyse umfasst die Extraktion von Partikeln von den Medizinprodukten durch Spülen mit Reinstwasser. Es erfolgt anschließend eine direkte Zählung und Vermessung der Partikel in einer definierten Menge des Extraktes im OPZ.
Mikroskopische Auswertung
Für die mikroskopische Auswertung werden die Partikel ebenfalls durch Spülen oder Ultraschallbehandlung extrahiert. Die extrahierte Flüssigkeit wird durch Filter geleitet, und die Partikel werden auf dem Filter gesammelt. Der Filter wird dann unter dem Mikroskop analysiert.
Wie werden die Partikel vermessen?
Optischer Partikelzähler (OPZ) - Flächenäquivalenter Kreis
Die Partikelvermessung im OPZ basiert häufig auf dem Prinzip der Lichtblockade. Die Größe der Partikel wird über die Fläche des geworfenen Schattens bestimmt und als Durchmesser des flächenäquivalenten Kreises (dp) dieses Schattens in µm ermittelt. Die Partikelanzahl wird durch die Anzahl der Zählereignisse ermittelt.
Mikroskopische Auswertung - Partikellänge
Die Partikelvermessung unter dem Mikroskop erfolgt durch manuelle oder automatisierte Zählung und Messung der Partikel. Die Größe der Partikel wird durch die Partikellänge (Feretmax) bestimmt, gemessen in µm als den größten möglichen senkrechten Abstand zweier Parallelen, die den Partikel berühren. Die Partikelanzahl wird durch die Anzahl der sichtbaren Partikel auf dem Filter ermittelt.
Wie vergleichbar sind die Analyseergebnisse?
Die Analysenergebnisse zwischen optischen Partikelzählern und mikroskopischer Auswertung sind nicht vergleichbar. CleanControlling hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und beurteilt die Vergleichbarkeit der Analysemethoden aufgrund folgender Beobachtungen:
Zwei fundamentale Unterschiede führen zu oftmals grundlegend unterschiedlichen Ergebnissen. Zum einen ist der Wert des flächenäquivalenten Durchmessers stets kleiner als die Partikellänge nach Feretmax. Die einzige Ausnahme stellt der Kreis bzw. die Kugel dar. Hier gilt Feretmax = dp. Des Weiteren muss der Einfluss der Orientierung des Partikels relativ zur Achse „Lichtquelle – Sensor“ im Moment der Detektion in Betracht gezogen werden. In der mikroskopischen Analyse kann, da der Partikel auf einem Filter aufliegt, davon ausgegangen werden, dass sich dieser mit der größten Auflagefläche präsentiert. In erster Näherung entspricht somit die gemessene Länge dem wahren Feretmax Wert.
Die Untersuchung mittels OPZ findet hingegen in einem sich bewegenden Fluid (Gas oder Flüssigkeit) statt. Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass, im Moment der Detektion, sich der Partikel in einer zufälligen Orientierung relativ zur Lichtachse befindet und sich nicht mit der größten Fläche präsentiert. Ob der, in dieser Orientierung geworfene Schatten und somit dp größer oder kleiner ist als der durch die lichtmikroskopische Untersuchung erhaltene Wert hängt, sehr stark von der Geometrie des Partikels ab. Da jeder Partikel nur einmal und in einer zufälligen Orientierung abgelichtet wird, kann der so ermittelte Wert für dp teils erheblich von dem durch die lichtmikroskopische Aufnahme erhaltenen Wert abweichen.
Mit Hilfe von Simulationen konnte gezeigt werden, dass konvexe Partikel (ohne Aussparungen) im Mittel 0-20%größere Werte für dp aufweisen, wenn sie mittels OPZ vermessen werden. Konkave Partikel (mit Aussparungen, siehe Beispiel) zeigen im Mittel einen um 10-25% kleinerer Wert für dp.
Relevante Normen
Für die Prüfung der Partikelbelastung von Medizinprodukten oder deren Reinigungsprozesse sind überwiegend folgende Normen relevant:
USP 788
USP 788 beschreibt die Anforderungen und Methoden zur Bestimmung der Partikelanzahl in Injektionen und parenteralen Infusionen. Es werden zwei Hauptmethoden beschrieben: die Lichtblockade (OPZ) und die mikroskopische Zählung.
VDI 2083 Blatt 21
Diese Richtlinie bietet einen risikobasierten Ansatz zur Identifizierung und Bewertung von Partikelkontaminationen in Medizinprodukten während des Herstellungsprozesses. Sie legt Akzeptanzkriterien und Methoden zur Überprüfung der Reinheit fest.
VDA 19.1 / ISO 16232:2018
VDA 19.1 bzw. ISO 16232:2018 ist die Richtlinie zur Prüfung der Technischen Sauberkeit von Automobilkomponenten, die auch auf Medizinprodukte angewendet werden kann und wird. Sie beschreibt Verfahren zur Partikelanalyse und legt die Klassifizierung von Partikelgrößen fest. Als Standardprüfung ist hier die automatisierte lichtmikroskopische Analyse mit Messung (Feretmax), Zählung und Typisierung nach metallisch glänzend und nicht glänzend vorgegeben.
Fazit
Beide Methoden, der optische Partikelzähler und die mikroskopische Auswertung, haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Probe und den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Norm ab.
Optische Partikelzähler sind eher für schnelle und automatisierte Lösungen geeignet, während mikroskopische Analysen detaillierte Informationen über die Partikelzusammensetzung liefern. Beide Methoden haben spezifische Anwendungsbereiche und können sich ergänzen, um eine umfassende Partikelanalyse zu gewährleisten.
Newsletter Anmeldung