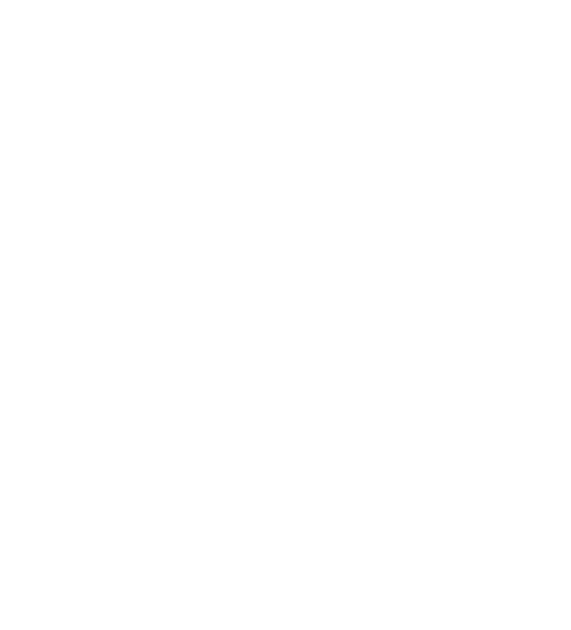Die 3. Ausgabe der VDA 19.1 - Was wird neu sein?
Der Mobilitätswandel, aber auch allgemeine technologische Entwicklungen in der Automobilindustrie gehen nicht spurlos an bestehenden Normenwerken vorbei. So ist auch die Technische Sauberkeit durch neue Anforderungen im Zuge des Wandels zur E-Mobilität, Assistenzsystemen und autonomem Fahren sowie durch allgemeine Trends in der Technischen Sauberkeit gefordert. Daher ist nun eine Revision der VDA 19.1 für die Prüfung der Technischen Sauberkeit unerlässlich.
Unter Federführung des Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat der Industrieverbund TecSa 3.0 in den letzten zwei Jahren eine Überarbeitung der VDA 19.1 ausgearbeitet. Die Revision 3.0 liegt inzwischen als Manuskript vor und wird in Kürze in die Gelbdruckphase überführt. Die finale Ausgabe der VDA 19.1 2025 wird im November 2025 erwartet. Heute sind zumindest wesentliche Ziele und Änderungen der neun Ausgabe bekannt, die wir nachfolgend in Kurzform wiedergeben wollen.
Was sind die neuen Anforderungen an die Technische Sauberkeit?
Der Wandel hin zur E-Mobilität und Assistenzsystemen konfrontiert die Technische Sauberkeit zunehmend mit neuen Themen. Die Überarbeitung der VDA 19.1 zielt daher insbesondere auf diese neuen Anforderungen ab:
- Neue Schädigungsmechanismen (Kurzschluss, Luft- und Kriechstrecken, Übergangswiderstände, Schädigung von Isolationsschichten, optische Blockade, etc.)
- Auf Schädigungsmechanismen ausgerichtete Sauberkeitsspezifikationen (Leitfähigkeit, Härte, etc.)
- Kleine Partikel (< 50μm) (Kameras, Sensoren)
- Trockene Prozessketten
- Komplexe Systeme mit durchgängigen Sauberkeitsgrenzwerten (HV-Systeme)
- Große und schwere Bauteile sowie Prüfung von Funktionsbereichen statt ganzer Bauteile (z.B. Batteriewannen)
Was sind die wesentlichen Ziele der Revision?
Grundsätzlich soll die VDA 19.1 in ihrer Struktur mit Kapiteln und Unterkapiteln wie bisher beibehalten werden, neue Themen werden in diese Struktur integriert, so dass Verweise aus anderen Dokumenten weitgehend beibehalten werden können. Die Umsetzung in Management- oder Prüfdokumentationen stellt daher keinen großen Aufwand dar.
Seit der Erstausgabe der VDA 19.1 vor 20 Jahren hat die Technische Sauberkeit mittlerweile für die Mehrzahl der Bauteile und Systeme in der Automobilindustrie eine durchgängige Bedeutung erlangt und ist somit ein etabliertes Qualitätsmerkmal. Damit hat auch die Prüfung der Technischen Sauberkeit durch Sauberkeitslabore deutlich zugenommen und die inzwischen große Anzahl von Laboren bei Herstellern und Dienstleistern erfordert verschiedene Präzisierungen und Anpassungen an Trends, um die Vergleichbarkeit der Prüfungen zu gewährleisten.
Die neue Ausgabe soll daher auch den vollständig standardisierten Ablauf der Prüfung - von der Verpackung und Anlieferung der Prüflinge bis zur normgerechten Auswertung - präzise beschreiben und damit keine weiteren Unsicherheiten in der Kunden-Lieferanten-Beziehung entstehen lassen. Die VDA 19.1 soll aber auch die Rahmenbedingungen für freie, fallspezifische Prüfungen beschreiben.
Generelles zur Sauberkeitsprüfmethode
Der Zweck der Sauberkeitsprüfungen lassen sich für verschiedene Fälle unterscheiden:
- Nachweis von Sauberkeitsgrenzwerten: Die im Kunden-Lieferantenverhältnis als Qualitätsmerkmal festgelegten Sauberkeitsspezifikationen werden mit der Sauberkeitsprüfung geprüft und dokumentiert. Für den zuverlässigen Nachweis werden in der VDA 19.1 die bestimmten Anforderungen und Parameter präzise vorgegeben. So ist z.B. die ausreichende Extraktionswirkung mittels Abklingmessung zu belegen. Hier kommet die “Grenzwertprüfung” mit festgelegten oder vereinbarten Parametern zur Anwendung.
- Monitoring zur Prozessüberwachung: Hierfür sind Prüfmethoden geeignet, die viele Ergebnisse in kurzer Zeit mit möglichst geringem Aufwand liefern und Prozessänderungen aufzeigen. Die Anforderungen an Standardprüfungen kommen hier i.d.R. nicht zur Anwendung. Im bisherigen Kontext handelt es sich um “verkürzte Analysen”
- Ursachenforschung:In der Regel sind hier spezifischere Informationen zu Partikeln, wie z. B. das Material, notwendig. Die Prüfmethoden weichen hier i.d.R. von der Standardprüfung ab oder es sind erweiterte Analysenmethoden wie z.B. REM/EDX- oder IR-Analysen erforderlich. Hierbei handelt es sich um “weitergehende Analysen”
In der Regel besteht die Sauberkeitsprüfung aus drei Stufen:
- Extraktion der Partikel: Die Partikel werden mittels flüssigem Reinigungsmedium, Luft oder adhäsiven Stempeln vom Bauteil gelöst.
- Abscheiden der Partikel: Die gelösten Partikel werden auf einen “Probenträger”, dem Analysefilter oder Partikelfalle abgeschieden.
- Analyse der Partikel: Der Analysefilter oder die Partikelfalle wird lichtoptisch oder mittels REM/EDX hinsichtlich Menge, Größe und Material analysiert.
Was sind die wesentlichen Änderungen in der VDA 19.1?
Erweiterung der Anwendungs- und Gültigkeitsbereiche
Die VDA 19.1 wird nun zwei Wege zur Prüfung von Sauberkeitsgrenzwerten vorsehen:
- Standardprüfung für möglichst große Vergleichbarkeit:
Mit definierten Startparametern für die Extraktion, Analysefilter und Standardanalyse, die ohne weitere Absprachen im definierten Anwendungsbereich verwendet werden kann. - Freie Prüfung für spezielle Fragestellungen:
Mit Flexibilität bei Parametern, Analysefilter und Analyse. Diese müssen dann im Kunden-Lieferanten-Verhältnis abgestimmt sein.
Erweiterung der Prüfmethoden
Die Erweiterung der Prüfmethoden trägt insbesondere den neuen Anforderungen aus dem Bereich der Elektromobilität Rechnung. Aber auch normative Lücken zu langjährig praktizierten Flüssigprüfverfahren werden nun geschlossen.
Trockenextraktion
Ergänzend klassischen Flüssigextraktion spielt nun die Trockenextraktion mit der Aufnahme neuer trockener Extraktionsverfahren eine wichtige Rolle. Die bisherige “Luftextraktion” mit Abblasen und Durströmen wird durch die Trockenextraktion ersetzt und beinhaltet nun neben diesen klassischen Methoden auch das Saugen sowie den Stempeltest.
- Das Saugen erweitert nun das Prüfspektrum insbesondere für große und unhandliche Bauteile. Die Prüfteile müssen bei der Saugextraktion nicht in eine Kammer oder ein Becken eingebracht werden und können so auch ohne Transport in ein Sauberkeitslabor extrahiert werden.
- Der Stempeltest ermöglicht die einfache Prüfung von Teilflächen, deren Sauberkeit spezifiziert sind, und kann damit auch direkt in der Fertigung durchgeführt werden.
Flüssigextraktion - Niederdruckspritzen
Bei der Flüssigextraktion wurde neben dem bisherigen “Spritzen” das Niederdruckspritzenaufgenommen. Im Gegensatz zum “Spritzen”, bei dem mit die Reinigungswirkung mit dem Impuls des Spritzstrahls maßgeblich unterstützt wird, erfolgt die lösende Wirkung beim Niederdruckspritzen lediglich durch die über die Oberfläche ablaufende Flüssigkeit. Das Niederdruckspritzen wurde bisher in der Praxis bei offenen Spritzeinrichtungen, also offene Extraktionssysteme oder Glasware angewendet, weil der in der VDA 19.1 festgelegte Spritzdruck (Startparameter Volumenstrom 1,5 l/min) hierfür nicht praktikabel ist. Damit ist das bisher praktizierte Niederdruckspritzen mit < 1 l/min Volumenstrom nun normativ beschrieben. Allerdings sind die Methoden aufgrund der sehr unterschiedlichen Reinigungswirkung nicht vergleichbar und müssen zukünftig zielgerichtet ausgewählt und entsprechend dokumentiert werden.
Die Analyse - Erweiterte Kriterien und Methoden
Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Fasern und Partikel < 50 µm werden folgende Kriterien und Methoden erweitert:
Faserlänge:
Oft ist nicht die einzelne Faser, aber die Gesamtmenge der Fasern funktionskritisch. Auch kann im Prozess nicht die Faserlänge einzelner Fasern beherrscht werden, sondern lediglich der Gesamteintrag an Fasern. Das neue Kriterium "Gesamtfaserlänge” als Summe der gestreckten Längen der einzelnen Fasern ermöglicht zukünftig die Reglementierung der Gesamtmenge von Fasern.
Freie lichtoptische Analyse:
Neben der lichtoptischen Standardanalyse für dunkle und metallische Partikel >50 µm auf weißem Analysefiltern, wird nun die freie lichtoptische Analyse die Erfassung von Partikeln <50 µm oder helle und kontrastarme Partikel beschrieben. Dieses Kapitel gibt exemplarische Ansätze zur zielgerichteten Analyse dieser Besonderheiten.
REM/EDX-Analyse:
Auch hier wird nun die REM/EDX-Analyse als Standard-Analyse mit definierten Einstellungen und definierten Materialklassen für Partikel >50µm detailliert beschrieben. Daher bedarf auch diese REM/EDX-Standardanalyse keiner Abstimmung im Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Sofern hiervon abweichende Fragestellungen vorliegen, z.B. Partikel <50 µm oder andere Partikelmaterialien, u.a. auch organische Materialien, wird auch hier die freie REM/EDX-Analyse einen Rahmen vorgeben.
Fazit
Die 3. Ausgabe der VDA 19.1 bringt wesentliche Neuerungen und Anpassungen, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht werden. Insbesondere die Berücksichtigung neuer Schädigungsmechanismen und die Einführung spezifischer Sauberkeitsanforderungen für kleine Partikel und komplexe Systeme stellen entscheidende Fortschritte dar. Die Erweiterung der Prüfmethoden um Trockenextraktionsverfahren sowie die Anpassung der Analysekriterien an neue Anforderungen der modernen Automobiltechnik unterstreichen die Bedeutung der Technischen Sauberkeit als Qualitätsmerkmal. Insgesamt bietet die überarbeitete VDA 19.1 eine solide Grundlage für die Sicherung der Technischen Sauberkeit in der sich wandelnden Automobilindustrie und trägt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit moderner Fahrzeuge bei.
Newsletter Anmeldung